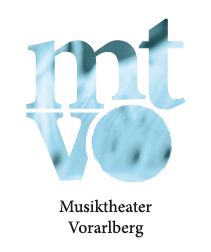
Aus Würfeln wird ein Königreich
Norbert Mladek über seine Cenerentola
Norbert Mladek ist der Regisseur der Opernaufführung La Cenerentola des Musiktheaters Vorarlberg in Götzis. Der vielseitig begabte, gebürtige Innsbrucker arbeitet als freischaffender Regisseur sowie als Bühnen- und Kostümbildner für Opern, Operetten und Musicals.
Bereits zum vierten Mal inszeniert er erfolgreich für das Musiktheater Vorarlberg und begeistert dabei sowohl das Publikum als auch die Mitwirkenden der jeweiligen Produktion. Über seine Arbeit und die aktuelle Produktion sprach er mit Chormitglied Elfriede Plangg.
Welchen Zugang für eine Operninszenierung hast du? Orientierst du dich an der Musik oder am Libretto?
Für mich ist beides wichtig! Rossini hat den Text von Jacopo Ferretti genauestens umgesetzt. Er weiß sogar in einigen Ensembles den durch die Worte entstehenden Klang als perkussives Element in der Oper zu nützen. Die Orchesterbesetzung selbst kommt ohne Schlagzeug aus.
Schaust du dir andere Inszenierungen an?
Da mein Konzept für unsere Inszenierung schon ausgearbeitet und im Februar präsentiert worden war, habe ich heuer ausnahmsweise die Bregenzer Aufführung dieses Sommers angesehen, allerdings nur aus dem Grund, weil uns zu Ohren gekommen ist, dass es auch dort quadratische Elemente in den Kostümen und auf der Bühne geben würde. Ich konnte dann aber erleichtert feststellen, dass meine Inszenierungen nichts, außer der Musik von Rossini, mit der Bregenzer Version zu tun haben wird.
Der Librettist Jacopo Ferretti hat das Märchen Aschenbrödel verändert, hat dich diese Version überzeugt oder hättest du dich lieber an der deutschen Version orientiert?
Nein, mir gefällt die Ferretti-Version, die sich allerdings ziemlich klar am Libretto „Cendrillon“ der Oper von Nicolas Isouard orientiert, sehr gut. Bei Jacopo Ferretti lernt der Prinz Aschenputtel in ihrem eigenen Umfeld kennen – und trotzdem kommen musikalisch von Anfang an keine Zweifel über ihre Empfindungen füreinander auf.
In welche Zeit, in welches Setting siedelst du die Handlung an?
Zeitlos!
In Ferrettis Deutung fehlt die Zauberfee; an deren Stelle hat die Figur des Alidoro, des Erziehers des Prinzen Ramiro, die Strippen in der Hand. Wie legst du ihn an?
Alidoro arbeitet nicht mit Magie, er ist in erster Linie ein weiser Mensch; er weiß die Figuren zu führen, aber die Lösung ihrer Probleme müssen sie selber finden.
Bei Rossini gibt es keine böse Stiefmutter, sondern einen bösartigen gnadenlosen Stiefvater, der seine Tochter aus erster Ehe am liebsten tot sähe. Gleich geblieben sind die beiden niederträchtigen Schwestern, die das Aschenputtel ausbeuten und schikanieren. Wie verhalten sie sich in deiner Inszenierung?
Genauso niederträchtig wie sie sind. Beide Schwestern sind überzeugt von sich, fühlen sich attraktiv und auf alle Fälle würdig, einen Prinzen zu heiraten. Dadurch entsteht auch zwischen den beiden Schwestern ein Konkurrenzkampf, der ebenso unerbittlich geführt wird.
Bei Rossini ist es auch kein Schuh, der die Wiedererkennung ermöglicht, sondern ein Armband. Für dich gelungen?
Das Armband ist ein Liebespfand und hat dadurch seine Rechtfertigung, allerdings hat unser Wiederfinden von Cenerentola durch den Prinzen etwas mit Erkennen zu tun. Der Hinweis dazu kommt von Alidoro und ist vielleicht ein stärkerer Impuls.
Wie interpretierst du Cenerentolas Lied „Una volta c’era un re“? Ist es die Sehnsucht nach Liebe, so gesehen zu werden, wie sie wirklich ist, ist es eine Art affirmativer Wunschäußerung? Angelina braucht keinen König, der „Diener“ ist genau richtig für sie. (für jedes Mädchen – laut Drewermann – ist der Geliebte ein König!)
Eugen Drewermann hat die deutschen Märchen analysiert und findet im Aschenbrödel eine Ursehnsucht nach Anerkennung, Dazugehören, Dabeisein, Geborgenheit und Liebe. Kommt das auch in deiner Inszenierung zum Ausdruck?
In ihrem Lied „Una volta c’era un re“ drückt sie ihre Einsamkeit aus; sie leidet am Ausgeschlossensein. Sie drückt ihre Hoffnung auf ein mitfühlendes Herz aus, das sie so nimmt, wie sie wirklich ist. Mit diesem Lied nimmt sie den Handlungsverlauf schon vorweg. Sie geht durch das ständige Wiederholen des Liedes den Schwestern auf die Nerven, und trotzdem singt sie es immer wieder, ja provoziert damit sogar.
Allerdings steckt auch eine Botschaft an die Menschen dahinter: In jedem/jeder steckt ein König/eine Königin. Man muss sich ihn/sie nur selbst erarbeiten, freilegen. König wird hier nicht als der Inhaber von Macht verstanden, sondern steht für die innere Kraft, die man braucht, um sich aus Zwängen, die einem umgeben, zu befreien, damit man sich frei entfalten kann. „Mein Prunk (Glanz) ist Tugend, Reichtum ist Liebe“ (Mio fasto è la virtù, ricchezza è amore.“ Cenerentola zu Ramiro 2.Akt, 2.Szene)
Wie hast du die Asche, an der Aschenputtel erniedrigende Arbeiten durchführen muss, gedeutet? Bedeckt sie sich mit Asche aus Trauer über den Verlust der Mutter – der Herd als Mittelpunkt des Heims, als Sinnbild der Mutter?
Bei uns wird es keinen Herd – besser offenes Feuer – geben. Aber trotzdem: „Stolz wird zu Asche werden.“ Das Feuer wird gehütet, das war ursprünglich eine priesterliche Aufgabe, die nur von reinen Frauen – Jungfrauen – ausgeführt werden durfte. In diesem Sinn ist Angelina rein und erreicht – durch ihre symbolische Arbeit in unserer Inszenierung – sich aus der Umklammerung zu lösen und Neues, ihre Zukunftsvision, zu kreieren und zum Leben zu erwecken.
Im Grimm’schen Aschenputtel geht das Mädchen dreimal zu ihrem Baum, um ein passendes Kleid für die große Einladung zu bekommen: Der Baum wächst, auch Aschenputtel wächst an ihren Herausforderungen. Wie wächst Angelina bei dir? Woran kann man ihre Heranreifung erkennen?
Sie erfährt beim Prinzen zum ersten Mal Liebe und Zuwendung; das gibt ihr die Energie und Kraft, sich nun gegen den Stiefvater aufzulehnen. Sie will aus ihrem häuslichen Alltag ausbrechen und spricht kraftvoll ihren Wunsch zum Ballbesuch aus. Auch wagt sie es, dem groben Stiefvater zu widersprechen; sie lebt und ist nicht gestorben, wie dies Alidoro klar ausspricht. Auch Drohungen lassen sie nicht mehr verstummen.
Bei Grimm muss Aschenputtel Linsen sortieren, Tauben (Sinnbild der Liebe) helfen dabei, was muss sie in „La Cenerentola“?
Sie sortiert ihre Welt, die die bunten darniederliegenden Bälle symbolisieren, und die von ihren Schwestern immer wieder zu Boden geworfen werden. Sie verwandelt ihren alten Lebensraum – die Farben werden geordnet. Der angedeutete Palast wird aber nicht als Zentrum der Macht, sondern als Ort einer neuen, guten Ordnung verstanden.
Don Magnifico – wie auch die anderen Figuren – erinnern an die Commedia dell’arte, wie zeichnest du ihn?
Er hat Züge der Commedia dell’arte, die immer wieder aufblitzen. Als Mensch sieht er sich in dieser Opera buffa schon geadelt – durch Heirat einer seiner Töchter mit dem Prinzen und dadurch in der Rolle des Herren, zu dem die Menschen mit ihren Anliegen unterwürfig reihenweise anstehen und er ihnen großzügig ihre Bitten – allerdings nur durch Bestechung – gewährt. Aber die Realität holt ihn ein, er glaubt, sein Traum (vom Esel) sei geplatzt, ohne zu verstehen oder zu erkennen, dass er sich in Angelina erfüllt. Er ist blind.
Die Schwestern Tisbe und Clorinda sind schon dem Namen nach lächerlich? Wie stellst du sie dar?
Ihre Komik entsteht durch ihre Tragik! Schönheit und Attraktivität sind das Wichtigste, das ist für sie das Einzige, das zählt, und ihnen die Welt – und den Prinzen – zu Füßen legen wird. Dadurch wirken sie lächerlich und zugleich entsteht daraus ihre Tragik. Es ist schwierig, komische Figuren zu zeichnen ohne sie der Lächerlichkeit preiszugeben.
Prinz Ramiro?
Er ist eine spannende Figur mit viel Empathie. Durch den Rollentausch mit seinem Diener Dandini erkennt er sich und sein bisheriges Verhalten als überheblicher und selbstgefälliger Herrscher, zwar überzeichnet, aber trotzdem spiegelbildlich. Der Prinz hat durch seine Erkenntnis die Möglichkeit sich zu ändern und dadurch Angelina gerecht zu werden.
Sein Diener Dandini?
Er ist ein moderner Hofnarr, der sich als einziger erlauben darf, seinen Chef zu imitieren und ihm den Spiegel vorzuhalten.
Ihr Rollentausch?
Jeder der beiden sieht den anderen in der eigenen Rolle und findet dadurch zu sich selbst.
Welche Rolle kommt dem Chor zu?
Der hier gemischte Chor stellt die Hofgesellschaft dar und spielt bei diesem karnevalesken Rollentausch mit. Diese Gesellschaft darf sich selber aufs Korn nehmen, Emotionen und Reaktionen zeigen, die bei Hofe des Prinzen undenkbar wären und sich selbst entlarven. Aber es gibt Unbelehrbare wie Don Magnifico und seine Töchter, die in ihrem Neid und ihrer Geltungssucht stecken bleiben.
Du führst nicht nur Regie, sondern hast auch das Bühnenbild entworfen. Wie schaut es aus? Was stellt es dar?
Alles ist gut „zusammengewürfelt“ – im wahrsten Sinne des Wortes. Aus drehbaren, veränderbaren Würfeln lassen sich unterschiedliche Bilder kreieren. Entweder bunt oder schwarz-weiß. Die Würfel zeigen den Weg – aus Unordnung wird Ordnung, aus schwarz-weiß wird Farbigkeit, Lebendigkeit. Schwarz-Weiß steht für Denken, Kühle, Macht, auch stellvertretend für das Hofzeremoniell.
Am Anfang und am Ende zeigen sich alle Würfel von der bunten Seite, das ist die Basis, die Vielfalt, aus der alles entsteht. Die oberste Plattform hingegen ist schwarz-weiß: Ein/e jeder/jede baut sich sein/ihr eigenes Königreich. Es soll ein Ansporn sein, das eigene Leben zu bauen, in die Hand zu nehmen, um in sein persönliches Königreich vorzudringen. Die Kostüme haben wir mit unserer Kostümbildnerin Nicole Wehinger farblich und stilmäßig mit unserem Konzept abgestimmt und unterstützen dieses. Farbe = Emotion, schwarz/weiß = kühle Berechnung.
Danke für das Gespräch! (Götzis, 5. September 2025)
